| |
Versuchsanleitung:

1.) Herstellung der Ausgangslösungen
Zur Herstellung einer Natronlauge werden 80g
Natriumhydroxid-Plätzchen in einem Meßkolben in ca.
150 ml destilliertem Wasser gelöst. Die Lösung
erwärmt sich dabei sehr stark. Nach Abkühlen auf
Raumtemperatur wird mit destilliertem Wasser auf 250
ml aufgefüllt.
Zur Herstellung einer gesättigten Kochsalzlösung
werden in einem Becherglas ca.150 g Kochsalz in 500
ml destilliertem Wasser gelöst. Man geht so vor, daß
man das Wasser auf 50-60° erwärmt und dann
portionsweise mit Kochsalz versetzt, bis sich nichts
mehr löst. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird
die Lösung vom Bodensatz abgegossen.
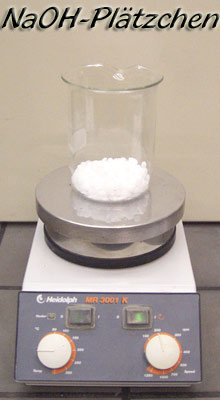


2.)
Synthese der Seife
Zur Seifensynthese werden 50 g Fett in einem
Becherglas auf ca. 90° erhitzt. Unter ständigem
Rühren werden nun 20 ml vorbereitete Natronlauge in
kleinen Portionen hinzugegeben. Es wird bei ca. 90°C
so lange erhitzt und gerührt, bis eine zähe Emulsion
entstanden ist. Dies dauert ca. eine halbe Stunde.
Vorsicht!


3.)
Aussalzen der Seife:
Zum Aussalzen der Seife wird im Anschluß an die
Synthese die rohe Seifenmasse im Becherglas mit 50
ml heißem Wasser (ca. 90°) versetzt. Unter Rühren
wird erhitzt, bis sich die Seifenmasse ganz
aufgelöst hat. Nun werden unter weiterem Rühren
ca.100 ml gesättigte Kochsalzlösung hinzugegeben. Es
bilden sich zwei Phasen. Zum vollständigen
Abscheiden der Seife über Nacht stehenlassen.
Im Becherglas hat sich auf der
Flüssigkeitsoberfläche eine feste Seifenschicht
gebildet, die sich mit Hilfe eines Spatels leicht
aus dem Becherglas herausheben läßt. Mit einem
Messer entfernt man die äußeren Schichten. So ergibt
sich ein Stück Roh-seife, das man für weitere
Versuche verwenden kann. Die Seife enthält noch
beträchtliche Mengen an Lauge. Die Rohseife sollte
deshalb nicht zur Körperreinigung verwendet werden.
|
|
| |
Erklärung
/ Hintergrund:
Seife ist an sich ein Alkaliesalz einer Fettsäure,
besteht also aus einem langen, apolaren Schwanz von
Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, und einem
geladenen Endstück, der Carboxylgruppe, mit dem
entsprechenden Na+ oder K+- Ion.
Fette, oder Öle, die die Ausganssubstanz für die
Produktion von Seifen sind, bestehen aus drei dieser
Fettsäuremoleküle, verestert mit einem Triol,
Glycerin. Dieser Ester läßt sich, katalysiert durch
OH- -Ionen, spalten:
Kocht
man Fette mit Hydroxid- oder Carbonatlösung, so
entstehen die Alkalisalze der Fettsäuren
(Seifen) :
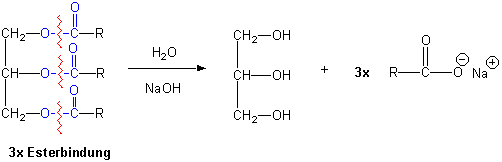
Von dieser
Reaktion stammt auch die allgemeine Bezeichnung
"Verseifungsreaktion" für Esterspaltungen.
|
|
| |
Sonstiges:
Die erste große Erfindung des nach Sauberkeit
suchenden Menschen war zweifellos die Entdeckung,
daß heißes Wasser einen weitaus besseren
Saubermacher als kaltes abgibt. Feuer macht aber
nicht nur Wasser “waschkräftiger” sondern verwandelt
auch Holz in Asche; und Asche ergab, mit heißem
Wasser ausgezogen, ein noch besseres
Reinigungsmittel: die Aschen- oder Waschlauge.
Wann und wo man diese Methode zuerst anwandte, und
wann man entdeckte, daß ein Zusatz von gebranntem
Kalk die alkalische Wirkung steigert, weiß niemand.
Schon im Altertum dürfte Holzaschenlauge vor allem
bei den Stämmen in Nord- und Mitteleuropa ein
gebräuchliches Reinigungsmittel für Felle, Gewebe
und Gebrauchsgegenstände gewesen sein.
Ein “anrüchiges” Reinigungsmittel In den
hochentwickelten Kulturen der damaligen Zeit, bei
den Ägyptern, Griechen und Römern, bediente man sich
eines Reinigungsmittels animalischer Herkunft, gefaulten
Urins.
Neben dem bereits beschriebenen fauligen Urin als
Reinigungsmittel kannten die alten Ägypter mit
großer Wahrscheinlichkeit auch Seife, ohne deren
gute Reinigungswirkung, zumindest im ausreichenden
Maße, realisiert zu haben. Einige tausend Kilometer
von Ägypten entfernt, im Gebiet zwischen Euphrat und
Tigris, dem jetzigen südlichen Irak, setzte man
Seife bereits als Waschmittel ein. Eine 2500 v. Chr.
datierte Tafel mit sumerischen Schriftzeichen
berichtet vom Waschen von Wolle mit Seife. Andere
Tafeln enthielten Rezepte, wie man aus Öl und
Pottasche Seife herstellt.
In Gallien und Germanien haben die Römer die Seife
kennengelernt. Was Plinius der Ältere in seiner
berühmten Enzyklopädie, der “Historia naturalis”,
schreibt, weist allerdings noch nicht darauf hin,
daß die Römer angesichts der Seife auch gleich ans
Waschen gedacht hätten. Wie sollten sie auch? Denn
die Gallier und Germanen zeigten ihnen offenbar
lediglich, wie gut sich mit Seife modische
Haarrollen festigen ließen.
Die Römer freundeten sich derartig mit der
Seifenpomade an, daß sie auch in ihrer Hauptstadt
nicht darauf verzichten wollten. In fester Kugelform
führten sie die Seife aus den nördlichen Ländern
ein, die sie erobert hatten. Erst seit 167 n. Chr.
haben die Römer mit Sicherheit Seife auch als
Reinigungsmittel benutzt. Der damals in Rom tätige
Arzt Galenus beschrieb die Seife und gab dabei an,
daß sie aus Fett, Aschenlauge mit Kalk hergestellt
werde. Sie mache die Haut weich und löse den Schmutz
von Körper und Kleidern.
Interessant ist die Rolle der Seife als Heilmittel.
Schon im dritten Jahrtausend vor Christus diente sie
der ärztlichen Behandlung. Im ältesten Dokument, das
bisher bekannt ist, auf einer sumerischen
Apothekertafel aus dem Jahr 2200 v. Chr., ist ein
Rezept für Seife angeführt, die mit Pflanzenmilch,
Salz und Zimtöl sowie Bier eine wirksame Salbe
ergibt.
Kernseife:
Viele hundert Jahre sollten noch vergehen, bis
die Kunde von der ersten festen Seife, also der Natron-
oder Kernseife, wie wir heute sagen, bekannt
wurde. Man schreibt diesen Verdienst den Arabern zu,
die etwa im siebenten Jahrhundert n. Chr. die
Kaustizierung der Siedelauge mitÄtzkalk gekannt und
auf diese Weise feste Seife hergestellt haben.
Über den Mittelmeerraum, überall dort wo der Ölbaum
gedieh, verbreitet sich die Kunst des Seifensiedens
zuerst nach Süd- und später nach Mitteleuropa. Vor
allem die mit betörenden Düften versehenen
Seifen waren in der damaligen eleganten Welt
nicht mehr aufzuhalten. In den Palästen der
Renaissancefürsten legten die Höflinge und ihre
Damen einen gewissen Wert auf Sauberkeit; noch mehr
Wert legten sie aber darauf, gut zu duften. Es gab
regelrechte Duftmoden und die Seifenherstellung
erfuhr, besonders von Paris her, immer neue
Anregungen .
So wie heute teure und exquisite Parfums aus
Dutyfree-Shops begehrte Mitbringsel sind, so legten
die Kreuzfahrer im 12. Jahrhundert die berühmten und
duftenden Seifenkugeln aus Damaskus, und die
Ritter und Kaufherren im 15. und 16. Jahrhundert
jene aus Venedig ihren Damen zu Füßen. Diese
Seifenkugeln waren übrigens bereits mit
Warenzeichen, wie Lilie, Tannenzapfen oder Halbmond
versehen.
Der
Siegeszug der Seife
Der Siegeszug, vor allem der Seife als
luxuriöses Kosmetikum, war nicht mehr aufzuhalten.
Paris, Venedig, Genua und Köln waren bald für ihre
wohlriechenden Seifen bekannt und berühmt. In
England und den Niederlanden entwickelte sich sogar
eine eigene Seifenindustrie. Die Seifensiederzunft
entstand (1337 in Wien, 1336 in Prag und 1324 in
Ulm). Erst in der Mitte unseres Jahrhunderts verlor
in zunehmendem Maß die Kernseife (Stückseife) ihre
dominierende Rolle bei der Reinigung der Wäsche
(moderne Vollwaschmittel).
Unbestritten ist jedoch ihre Bedeutung auf dem
Gebiet der Körperpflege. Neue Forschungsergebnisse
und verbesserte Produktionstechnologien haben dazu
beigetragen, aus dem Luxusartikel von einst ein für
jedermann erschwingliches Kosmetikum zu machen und
die Bedeutung der Seife für die Körperhygiene
sicherzustellen.
|
|